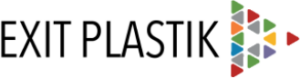Am 3. Juli 2021 trat die Einwegkunststoffverbotsverordnung (EWKVerbotsV) in Deutschland in Kraft. Sie setzt die Einwegkunststoffrichtlinie der EU von 2019 um, die es nicht mehr erlaubt, bestimmte Einwegkunststoffartikel in den Mitgliedstaaten in den Verkehr zu bringen; für andere Artikel müssen Maßnahmen zur Verbrauchsminderung ergriffen werden und es gelten neue Kennzeichnungsvorschriften.
Zum zweijährigen Jubiläum der Verordnung lohnt sich eine Bestandsaufnahme: Wurden die Vorschriften in Deutschland umgesetzt und lassen sich schon Erfolge messen? Reichen die Maßnahmen der Verordnung überhaupt aus, um die Ziele zu erreichen oder gibt es Nachbesserungsbedarf?
Einwegkunststoffverbotsverordnung überträgt europäische Richtlinie in deutsches Recht
Hierzu erst einmal der Kontext und rechtliche Rahmen der Verordnung: Die EU hat im Jahr 2015 den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft und im Jahr 2018 eine gesonderte Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft verabschiedet. Die Einwegkunststoffrichtlinie aus dem Jahr 2019 schließt daran an, und konstatiert dass es vor allem die Kunststoffe sind, die für den einmaligen Gebrauch produziert werden und deren Lebensdauer nicht durch Wiederverwendung oder Recycling verlängert werden kann, die im Widerspruch stehen zu kreislauforientierten Ansätzen, die auf nachhaltige und nichttoxische wiederverwendbare Artikel und Wiederverwendungssysteme setzen.
Als oberstes Ziel verfolgt die Richtlinie die Reduzierung des Abfallaufkommens; und sie soll verhindern, dass Kunststoffe in die Umwelt und vor allem in die Meere gelangen. Dementsprechend wurden Daten von Abfallzählungen an Stränden herangezogen, um die problematischsten Einwegkunststoffartikel für die Meeresumwelt zu identifizieren. “Die Einwegkunststoffartikel, die unter Maßnahmen im Rahmen dieser Richtlinie fallen, machen Schätzungen zufolge etwa 86 % aller Einwegkunststoffe aus, die bei Müllzählungen an Stränden in der Union vorgefunden wurden”, heißt es im Text der Richtlinie.
Bei den Maßnahmen, die von den Mitgliedsstaaten umzusetzen sind, unterscheidet die Richtlinie zwischen solchen Einwegkunststoffartikeln, für die bereits nachhaltige und erschwingliche Ersatzprodukte zur Verfügung stehen, und solchen, für die es noch keine geeigneten Alternativen gibt. Erstere sind von den Mitgliedstaaten zu verbieten, zweitere sollen zumindest mit Verbrauchsminderungszielen belegt werden.
Beschränkungen für das Inverkehrbringen gelten zum Beispiel auf Wattestäbchen, Besteck und Teller oder Trinkhalme; Verbrauchsminderungen soll es für Getränkebecher und Lebensmittelverpackungen wie Take-Away-Boxen aus Kunststoff. Zudem werden verschärfte Sensibilisierungsmaßnahmen zur Vermeidung und Entsorgung von Einwegkunststoffprodukten eingeführt, wie beispielsweise Tabakfilter, Hygieneeinlagen, Feuchttücher und Luftballons. Bei PET-Einwegflaschen soll eine verbindliche Recyclateinsatzquote festgelegt werden: ab 2025 mindestens 25 Prozent und ab 2030 mindestens 30 Prozent bei allen Einwegflaschen. Ein Teil der Einwegkunststoffprodukte unterliegt auch besonderen Kennzeichnungspflichten, wodurch die Konsument:innen über deren ordnungsgemäße Entsorgung auf einen Blick informiert werden – diese Kennzeichnung wurde in einer eigenen Verordnung, der Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung, festgelegt.
Was hat die Verordnung bereits bewirken können?
Kurz nach Inkrafttreten der beiden neuen Verordnungen, im Frühjahr 2021, führten die Verbraucherzentralen aus Bayern und Hamburg sowie der Bundesverband eine Untersuchung unter Gastronomiebetrieben durch. Was hatte sich durch die neuen Pflichten verändert? Es zeigte sich leider, dass dem Trend zu Einweg kein Einhalt geboten werden konnte. Statt auf Mehrwegbehältnisse und -getränkebecher umzusteigen kamen eher Ersatzmaterialien wie Papier zum Einsatz, die weiterhin zur Abfallflut beitragen. Die Umweltbilanzen solcher Alternativen sind oft wenig besser als die der verbotenen Kunststoffartikel – die Herstellung von Papier zum Beispiel hat einen hohen Flächenverbrauch und ist ein Grund für massive Abholzungen von Waldgebieten. Auch ein ganzes Jahr nach der Implementierung war die Bilanz der Deutschen Umwelthilfe (DUH) über die Wirksamkeit der neuen Verordnungen ernüchternd: es gäbe zu wenige Kontrollen, sodass die Einweg-Plastikprodukte weiterhin in den Umlauf gelangen, oder Plastikartikel würden teilweise einfach als “Mehrweg” oder “wiederverwendbar” deklariert, obwohl sie de facto weiterhin nach einmaliger Benutzung im Abfall landen.
Den Mehrweg gehen und nicht nur Kunststoff ersetzen
Nicht der Umstieg von Kunststoff auf Papier, Holz oder Aluminium, sondern der Umstieg von Einweg auf Mehrweg ist der richtige Weg, um Abfall zu vermeiden und Meeresmüll zu bekämpfen. Scheinbar nachhaltigere Materialien einzusetzen, aber an der Einweg- und Wegwerfmentalität nichts zu ändern, wird nicht die notwendige Reduzierung des Abfallaufkommens bringen. Es braucht Maßnahmen und Anreize für Gewerbetreibende und Verbraucher:innen, um die Entscheidung für Mehrweg leichter zu machen. Die nachhaltigere Lösung muss auch die attraktivere Lösung sein. Die seit Anfang 2023 in Deutschland geltende Mehrwegangebotspflicht, oder die kürzlich bestätigte Verpackungssteuer in der Universitätsstadt Tübingen sind rechtliche Instrumente die den Weg in die richtige Richtung weisen. Wesentlich ist aber auch die konsequente Kontrolle durch die Behörden, damit beispielsweise die Mehrwegangebotspflicht auch wirklich von den Betrieben umgesetzt wird und kein leeres Versprechen bleibt. Die Betriebe müssen über ihre Pflichten aufgeklärt werden und bestmöglich bei der Einführung von Mehrweglogistik oder Pfandsystemen unterstützt werden, damit vor allem kleine Betriebe nicht unter den Kosten leiden. Es gibt positive Lösungsansätze, die politisch mehr gefördert werden müssen, wenn die Abfallhierarchie eingehalten, eine messbare Abfallreduktion erreicht und den negativen Auswirkungen von (Meeres-) Müll für Umwelt und Gesundheit entgegengewirkt werden soll.